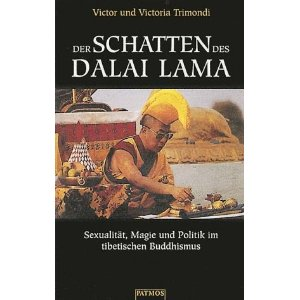| Home » 文章分类_德语 » Kritik an Lamaismus |
Begründete Zweifel |
Begründete Zweifel© http://www.trimondi.de/interv06.html Der tibetische Buddhismus gilt im Westen als Vorbild für Friedfertigkeit, Tantra als Inbegriff von «Heiligem Sex». Ein völlig anderes Bild zeichnet das Buch «Der Schatten des Dalai Lama» von Victor und Victoria Trimondi. YABYUM erläuterten sie die wichtigsten Punkte ihrer Kritik: die militante Machtpolitik des Dalai Lama, Sexualmagie und Frauenverachtung. YABYUM: Ihre kritische Auseinandersetzung mit dem Dalai Lama, dem tibetischen Buddhismus und der damit verbundenen Politik füllt einen Wälzer von über 800 Seiten. Was war der Anlass, sich mit der Problematik in dieser Breite und Tiefe zu beschäftigen? Victor und Victoria Trimondi: Als wir vor fünf Jahren mit den Recherchen zu unserem Buch begannen, hatten wir durchaus ein positives Verhältnis zum tibetischen Buddhismus. Wie sehr viele Menschen glaubten wir, dass der Dalai Lama die sozial-politischen und individuellen Werte, die auch uns am Herzen lagen, mit Mut und Überzeugung zum Ausdruck bringt: Friedfertigkeit, Mitgefühl mit allen leidenden Wesen, Überwindung der Klassen- und Rassenschranken, ökologisches Bewusstsein, Freiheit des Individuums, Transzendieren des Feindbilddenkens, Gemeinschaftssinn, soziales Engagement, interreligiöser Dialog, Begegnung der Kulturen und vieles mehr. Insbesondere aber waren wir vom Tantrismus angezogen, dem eigentlichen Kern des tibetischen Buddhismus. Hier schien es endlich eine Religion zu geben, welche die Gleichberechtigung der Geschlechter ernst nahm und den Eros nicht aus dem sakralen Raum verbannte, sondern ihn geradezu in sein Zentrum stellte. Aber nicht nur ideengeschichtlich waren wir mit dem XIV. Dalai Lama verbunden. Als Verleger habe ich Bücher von ihm publiziert, habe mehrere Symposien und Grossveranstaltungen für ihn organisiert. 1982 holte ich ihn mit einer kleinen Propellermaschine von Paris auf die Frankfurter Buchmesse. Das Flugzeug geriet in einen Sturm und schwankte abenteuerlich. Alle Insassen, einschliesslich des Dalai Lama wurden bleich. Solch extreme Momente im Leben schaffen Bindungen und es entwickelte sich eine, wenn auch lockere Freundschaft. Uns gefiel ganz besonders die religiöse Toleranz «Seiner Heiligkeit». Niemals fordert der XIV. Dalai Lama Menschen dazu auf, ihre angestammte Religion zu verlassen und sich dem Buddhismus anzuschliessen. Im Gegenteil – er warnt eindringlich vor einem Religionswechsel und betont immer wieder, es sei geradezu die Pflicht eines jeden, denjenigen Glauben, den er annehmen wolle, auf Herz und Nieren zu prüfen, ihm mit aller Skepsis und mit einem völlig kritischen Geist gegenüberzutreten und dann erst seine Entscheidung zu fällen. Und das haben Sie gemacht? Das genau haben wir gemacht! In der Absicht, im tibetischen Buddhismus eine spirituelle Lehre zu entdecken, die Antwort weiss auf die Lösung unserer Weltprobleme, haben wir die Grundlagen des Buddhismus, die tantrischen Texte, die Geschichte des Tantrismus und die Biografien der frühen Tantriker studiert, ausserdem haben wir uns mit der Geschichte Tibets, der Dalai Lamas und der Politik der Exiltibeter auseinandergesetzt. Das Ergebnis war mehr als ernüchternd und führte zu einer völligen Revision unserer bisherigen Sicht. Statt einer friedvollen und toleranten haben wir eine kriegerische und aggressive Kultur vorgefunden; statt Frauenfreundlichkeit und Geschlechterparität haben wir ein System kennengelernt, dass die Unterdrückung und Ausbeutung der Frau durch sein Raffinement auf die Spitze treibt. Unterdrückung Andersdenkender, Despotismus, Intoleranz, grenzenlose Machtobsessionen, Dämonisierung und Angst als politisches Mittel, Verachtung alles Menschlichen – all das, was wir gerade nicht vermutet hatten, mussten wir in den Texten, den Ritualen und der Geschichte dieser Religion entdecken. Für uns war die Erkenntnis über die Schattenseiten des tibetischen Buddhismus zeitweise mit einer persönlichen Krise verbunden – denn es hiess Abschied nehmen von einer bisher von uns positiv besetzten Kultur und einem hochgeschätzten Menschen, einem spirituellen Vorbild und einem persönlichen Freund. Wie sind Sie bei Ihren Ermittlungen vorgegangen? Mittlerweile liegt ein umfangreiches Quellenmaterial über den tibetischen Buddhismus in vielen europäischen Sprachen vor. Ein Grossteil der Höheren und Höchsten Tantras wurden weltweit von den qualifiziertesten Tibetologen übersetzt und in vielen Fällen durch Englisch sprechende Lamas abgesichert. Methodisch haben wir uns nicht auf eine klassische Textkritik beschränkt. Das war auch niemals unsere Absicht, da wir ein kulturkritisches und tiefenpsychologisches Werk und keine tibetologische Abhandlung verfassen wollten. Weil es sich im Falle des tibetischen Buddhismus – was keineswegs allgemein bekannt ist – um ein mythologisches System handelt, genügt es nicht, dieses System einfach zu beschreiben. Wir haben uns methodisch von einem Grundsatz der modernen Ethnologie beeinflussen lassen. Um einen Mythos zu verstehen, um seine «Logik» zu erfassen – darüber gibt es unter Ethnologen verschiedenster Richtung einen Konsensus: Man muss in den «Bannkreis» des Mythos treten, darf sich jedoch selber nicht «bannen» lassen. Dann erst kann der Sinn des Mythos in eine wissenschaftliche Sprache übersetzt werden. Sie stellen in Ihrem Buch verschiedene Themenbereiche zur Diskussion, den militanten Shambala-Mythos beispielsweise mit dem Endziel einer Buddhokratisierung der Welt oder die Unterdrückung und den Missbrauch von Frauen im tibetischen Buddhismus. Welche Bedeutung hat das Thema Tantra? Der Tantrismus behandelt ein sehr delikates Thema, nämlich die Rolle der Geschlechter im sakralen Raum. In allen patriarchalen Religionen wurde die Frau schon vor Jahrhunderten aus den Mysterien vertrieben. Die zentralen gesellschaftlichen Positionen – als «Priester» oder als «Politiker» – nahm grundsätzlich ein männliches Wesen ein. Auch der historische Buddha und seine ursprüngliche Lehre zeigen stark androzentrische Züge. Der traditionelle Tantrismus in Indien und Tibet scheint auf den ersten Blick anders zu sein. Untersuchen wir jedoch differenziert die dort empfohlenen Praktiken und ihre Symbolzuweisungen, dann werden wir bald erkennen, dass es sich hierbei in den meisten Fällen um eine der raffiniertesten Methoden handelt, um die Geschlechterpolarität auszubeuten, insbesondere die Frau und die weiblichen Energie, die Gynergie. Die traditionellen Tantras erschöpfen sich jedoch – von ihrer Intention her – keineswegs als sinnlich-spirituelle Techniken, um den Eros der Geschlechter zu kultivieren und um die gleichwertige Ganzheit beider Partner herzustellen, so wie das vom westlichen Neo-Tantrismus gern und oft gesehen wird. Die Praktiken beinhalten vielmehr die sexualmagische Aktivierung von Symbolfeldern mit einem transpersonalen, d. h. theogonischen und kosmogonischen Inhalt. Tantra und Macht – persönliche, spirituelle und politische – gelten deswegen in allen uns bekannten einschlägigen Texten als Synonyme. In unserem Buch haben wir detailliert beschrieben, wie die Verbindung zwischen tantrischer Sexualmagie und Politik, zwischen einem Mythos – Shambhala – und einer buddhokratischen Endzeitvision im Kalachakra-Tantra, dem «König der Tantras», hergestellt wird. Ob man nun die Wirksamkeit einer solchen Praxis wie dem Kalachakra-Tantra ernst nimmt oder nicht – sie ist auf jeden Fall abzulehnen, weil sie kriegerische, grausame, frauenverachtende und despotische Züge aufweist. Von Kritikern Ihres Buches wird geltend gemacht, dass tantrische Texte und Bilder symbolische Bedeutung hätten und keinesfalls als Anleitung zur Praxis missverstanden werden dürften. Nebenbei bemerkt würde das heissen, dass Vorstellungen und Übungen des New-Age-Tantra purer Unsinn wären. Worauf gründet sich Ihre Haltung in dieser Frage? Die buddhistische Diskussion über die «nur symbolische» oder «reale» Bedeutung der Tantra-Texte ist so alt wie diese selbst. Sie ist auch ganz verständlich, denn bei der Ausübung des Vajrayana müssen fast alle ethischen Vorschriften des Vinaya Pitaka, der von Buddha verordneten Ordensregeln, durchbrochen werden. Zu den geforderten Regelverletzungen zählen ja nicht nur der Sexualverkehr, der für einen buddhistischen Mönch grundsätzlich verboten ist. Die Tantras fordern auch andere, sehr aggressive Akte, die sogar einen Mord einschliessen können. Der Diskurs «symbolisch» versus «realistisch» wurde auch in der tibetischen Tradition geführt, dabei lässt sich unter dem Strich sagen, dass fast alle bedeutenden Lamas von einer realen Durchführung der Sexualpraktiken ausgehen, gleichgültig, ob sie diese selber praktiziert haben oder nicht. Tsongkapa, der Gründer des Gelbmützenordens, zum Beispiel hat eine sehr «tugendhaftes» Image und man erzählt, er habe niemals mit einer realen Sexualpartnerin, einer Mudra, praktiziert. Ob dies nun stimmt oder nicht, mag dahin gestellt bleiben, Tsongkapa ist auf jeden Fall der Verfasser bedeutender tantrischer – sexualmagischer – Kommentare und seine Aussagen zur Symboldebatte ist eindeutig: «Eine weibliche Partnerin gilt als Basis für die Vollendung der Befreiung.» Wer sich mit der Materie intensiv beschäftigt, wird sehr schnell herausfinden, dass bei den höchsten Tantras reale Frauen bevorzugt werden oder sogar Vorschrift sind. Dies ergibt sich auch aus dem Sinn und der inneren Logik der Tantra-Texte, wie wir das ausführlich in unserem Buch dargestellt haben. Wie ist es denn zu erklären, dass darüber eine hitzige Debatte stattfindet? Zur Auffassung der reinen Symboldeutung der Tantras haben vor allem zwei Missverständnisse beigetragen: 1. Die exiltibetischen Lamas, mit dem XIV. Dalai Lama an der Spitze, sind hier im Westen demonstrativ als «zölibatäre Mönche» aufgetreten. Soweit damit der Verzicht auf Heirat gemeint ist, gilt dies nur für den Gelug-pa Orden, die Gelbmützen, nicht jedoch für die drei anderen Schulen Kagyü-pa, Sakya-pa und Nyingma-pa. Im tantrischen Ritual praktizieren aber auch die Gelug-pas mit realen Mudras. Miranda Shaw zitiert moderne Gelbmützen-Meister wie Lama Yeshe, Geshe Kelsang Gyatso und Geshe Dhargyey, die mit realen Frauen ihre Rituale durchgeführt haben sollen. June Campbell berichtet über ihr tantrisches Verhältnis zu dem sehr berühmten Kagyü-Meister Kalu Rinpoche. Beide Frauen sind Tibetologinnen und kennen als ehemals praktizierende Buddhistinnen das System von innen. 2. Ganz entscheidend für das Missverständnis, dass die tantrischen Texte nur einen Symbolwert hätten, war das Buch des deutschen Lama Anagarika Govinda «Grundlagen tibetischer Mystik». Dabei handelt es sich um einen Bestseller, durch den zahlreiche Menschen aus dem Westen zum ersten Mal ernsthaft mit dem tibetischen Buddhismus in Berührung gekommen sind. Govinda ist ein geradezu fanatischer Verfechter der «reinen Symbolthese» – Dakini als reine Seele – und er versucht mit grossem Eifer den tibetischen Buddhismus von jeglichem «sexuellen Schmutz» zu reinigen. Was für Konsequenzen haben Ihre Recherchen für das New-Age-Tantra? Wir haben in unserem Buch ganz offen zum Ausdruck gebracht, dass wir grundsätzlich der Sakralisierung der Sexualität, wie es der Tantrismus ganz allgemein fordert, sehr positiv gegenüber eingestellt sind. Voraussetzung ist jedoch, dass sich beide Partner vor, während und nach der tantrischen Performance als gleichwertige Pole anerkennen. Das ist, wenn wir die Symbolwelt der verschiedenen traditionellen Tantratexte – buddhistische und hinduistische – untersuchen, in keinem uns bekannten Fall garantiert. Grob teilen sich die Schulen in – wie wir es nennen – androzentrische und gynozentrische Ausrichtungen. Die tibetischen Schulen sind allesamt androzentrisch, sogar wenn man nach dem buddhistischen «Candamaharosana Tantra» praktiziert, ein Text, der immer wieder wegen seiner Frauenfreundlichkeit zitiert wird. Das sogenannte «New-Age-Tantra» versucht verbal die Gleichwertigkeit der Partner zu kultivieren und aufrechtzuerhalten. Diese müssen aber Acht geben, dass sie nicht die Opfer einer missverstandenen Symbolwelt und Symbolpraxis werden und dadurch unbewusst traditionelle Unterdrückungsmechanismen anwenden. Zum Beispiel sind benutzte Ritualgegenstände, Mudras – Handzeichen – oder Mantras oft die Mittel eines raffinierten Systems der Energieausbeutung und ihre naive und unreflektierte Übernahme durch «westliche» Tantra-Schulen kann die traditionellen Fehlentwicklungen wiederholen und festigen. Hinzukommt, dass sich das New-Age-Tantra zu sehr auf den körperlich-sexuellen Bereich – Lust und Sinnlichkeit – konzentriert und den intellektuell-metaphysischen Aspekt des Tantrismus naiv vernachlässigt. Dieser ist jedoch seit jeher Teil des tantrischen Weges. Es geht dabei jedoch um mikro-makrokosmische Dimensionen, deren Verständnis die Kenntnis einer «mystischen Wissenschaft» voraussetzt. Ebenfalls begrenzt und bedauernswert erscheint es uns, dass die seelische Ebene im New-Age-Tantra – ebenso wie im traditionellen Tantra – zu kurz kommt. Auch auf der psychischen Ebene ist – unserer Sicht nach – eine «mystische Vereinigung» der beiden Partner wichtig und wünschenswert. Die «unio mystica» der Seelen ist ein Ereignis, durch das die beiden Partner ihre Schönheit und Kraft erfahren können. Seelenbegegnungen sollten ebenso kultiviert, gelehrt und gelernt werden wie die physische metaphysische Begegnung von Mann und Frau. Es geht weiter um die ethische und humane Rolle in der Gesellschaft, die ein «erleuchtetes» Paar zu spielen hat. Genauso wie der traditionelle Tantrismus eine meta-gesellschaftliche Dimension umschliessen kann, deren problematische Seite wir in unserem Buch gezeigt haben, so sollte der «moderne Tantrismus» sozial-ethische und humanistische Verantwortungen übernehmen, anstatt allein individuelle Peak-Erlebnisse zu ermöglichen. Spiritualität verpflichtet, sie ist ein Geschenk, welches der Harmonie des Gleichgewichts in der Gesellschaft zu dienen hat. Vielleicht ist es an der Zeit, dass der «Neo-Tantrismus» seine egozentrische Einseitigkeit verlässt und sich in den Dienst einer kulturellen Erneuerung stellt. Das New-Age-Tantra mag – vorsichtig ausgedrückt – die Vorform einer neuen religiösen Kultur sein, welche die Geschlechterpolarität in ihr Zentrum stellt. Es bedarf aber – unserer Ansicht nach – noch sehr vieler zusätzlicher Komponenten, damit sich aus diesem «Milieu» ein wirklicher «Kulturentwurf» entwickeln kann. Was für Konsequenzen ergeben sich für den Buddhismus als Philosophie oder Religion, der vielen Menschen im Westen als derzeit einzige, jedenfalls überaus attraktive spirituelle Lehre und Lebensweise erscheint? Diese Frage zu beantworten, würde Seiten füllen, denn sie verlangt eine sehr komplexe Antwort, insbesondere da es uns nicht darum geht, das ganze System in Frage zu stellen, wie das zum Beispiel Colin Goldner in seinem Buch «Dalai Lama – Fall eines Gottkönigs» mit aller Bestimmtheit tut. Erste Voraussetzung für eine Veränderung ist immer ein kritisches und offenes Bewusstsein. Wir zitieren in diesem Zusammenhang gerne den folgenden Spruch des historischen Buddha: «Deine Zweifel sind begründet, Sohn des Kesa. Höre meine Weisung: Glaube nichts auf blosses Hörensagen hin; glaube nicht an Überlieferungen (!), weil sie alt und durch viele Generationen bis auf uns gekommen sind; glaube nichts aufgrund von Gerüchten oder weil die Leute viel davon reden; glaube nicht, bloss weil man dir das geschriebene Zeugnis irgendeines alten Weisen vorlegt; glaube nie etwas, weil Mutmassungen dafür sprechen oder weil langjährige Gewohnheit dich verleitet, es für wahr zu halten; glaube nichts auf die blosse Autorität deiner Lehrer und Geistlichen hin. Was nach eigener Erfahrung und Untersuchung mit deiner Vernunft übereinstimmt und deinem Wohl und Heil wie dem aller anderen Wesen dient, das nimm als Wahrheit an und lebe danach.» (Anguttara Nikaya I, 174) Zu dieser – von Buddha legitimierten und geforderten Kritik – zählt primär eine Auseinandersetzung mit den Mythen und traditionellen Dogmen sowie die Frage, ob diese heute immer noch mit den humanpolitischen Anforderungen unserer Zeit vereinbar sind. Wichtig in diesem Zusammenhang ist weiterhin ein kritischer Diskurs über die Geschichte des Buddhismus, über sein historisches Verhältnis zum Staat, zum Krieg, zur Geschlechterfrage usw. Keine Religion darf sich am Beginn des kommenden Jahrtausends einer solchen Befragung ihrer Geschichte entziehen. Ebenso notwendig ist die kritische Hinterfragung der Gegenwart, d. h. konkret die Auseinandersetzung mit den lebenden tibetischen Lehrern. Erst nachdem eine solche Kritik ehrlich durchgeführt wurde, sollte man sich für den tibetischen Buddhismus als Religion entscheiden oder es sein lassen. Was für Konsequenzen sind zu ziehen in Bezug auf das politische Engagement für ein freies Tibet? Ein politisches Engagement für ein «freies» Tibet wird heute weder von der exiltibetischen Regierung noch vom Dalai Lama gefordert, sondern nach der Strassburger Erklärung 1989 geht es ausschliesslich um die «Autonomie» Tibets unter chinesischer Generalverwaltung nach dem Hongkong-Modell. Ob ein solches Modell von den Exiltibetern wirklich ernst gemeint ist, können wir nicht beurteilen, jedenfalls läuft die Sympathisantenszene immer noch mit dem Spruch «Free Tibet» herum und schert sich wenig um die entscheidende völkerrechtliche Differenz zwischen «Autonomie» und «Souveränität». Wir möchten den Tibetern nicht in ihr politisches Konzept hineinreden. Grundsätzlich sind wir jedoch gegen jegliche Überbetonung des Nationalstaates, wie es heute wieder überall Mode ist. Die Tibeter müssen selber ehrlich beurteilen, ob sie von chinesischer Seite so unterdrückt werden, dass nur eine Loslösung von China der einzige Weg in die Freiheit ist. In jedem Fall sollten sich unter ihnen Menschen zusammentun, die sich konsequent aus den Strukturen des politischen Lamaismus emanzipieren und ihre autonomen Wege zum Nutzen ihres Volkes suchen. Dabei sollten ihnen Frauen und Männer aus dem Westen behilflich sein. Interview: Edi Goetschel |
| Home » 文章分类_德语 » Kritik an Lamaismus |

简体 | 正體 | EN | GE | FR | SP | BG | RUS | JP | VN Tibetischen tantrischen Wahrheit Zuhause | Gästebuch | LOGIN | LOGOUT
- Betroffenengeschichte des Tantrismus
- Chinmoy-Abuse
- Journal of True Enlightenment
- Krimineller Dalai Lama und Tibet - Gewalt
- Krimineller Dalai Lama und Tibet - Sexualpraktiken
- Kritik an Aggressivität
- Kritik an Dalai Lama
- Kritik an Lamaismus
- Kritik an Sexualpraktiken
- Ole Nydahl-Event
- Recommendable books
- Roach-Event
- Samyukta-Agama Sutra
- Swami-Abuse
- Thai Buddhist Scandal
- True Face of the Dalai Lama
- True Heart News
- True Meaning of Sutras
- True Wisdom of Buddhism
- Truth from insider of Lamaism
- Wahre Bedeutung der Sutren
- Wahre Weisheit des Buddhismus
- Wahrheit aus Insider des Lamaismus
- Behind the Facade of Tibetan Buddhism
- Widerlegung gegen Lamaismus
Bevor der Buddhismus in Tibet eingeführt wurde, hatten die Tibetaner "Bön" als Volksglauben gehabt. Bön verehrt Geister, Gespenster und Götter, um ihren Segen zu erhalten. Bön gehört also zu lokalen Volksglauben.
Während der chinesischen Tang Dynastie, führte der tibetische König Songtsän Gampo den Buddhismus in Tibet ein und machte ihn zur Staatsreligion. Der sogenannte "Buddhismus" ist aber tantrischer Buddhismus, der sich in der Spätzeit des indischen Buddhismus ausbreitet. Der tantrische Buddhismus wird auch "linkshändigen Pfad" genannt, weil er die tantrische sexuelle Praxis macht. Um zur tibetischen Kultur zu passen, wird der tantrische Buddhismus mit "Bön" gemischt. Er wird dann noch exzessiver wegen dessen Glaubens an Geister und Gespenster.
Der tantrische Meister Atiśa lehrte die tantrische Sex heimlich. Padmasambhava lehrte sie dann aber offen. Der tibetische Buddhismus weichte nicht nur von buddhistischen Lehren ab, sondern auch von buddhistischer Form. Der tibetische Buddhismus gehört nicht zum Buddhismus und muss "Lamaismus" genannt.